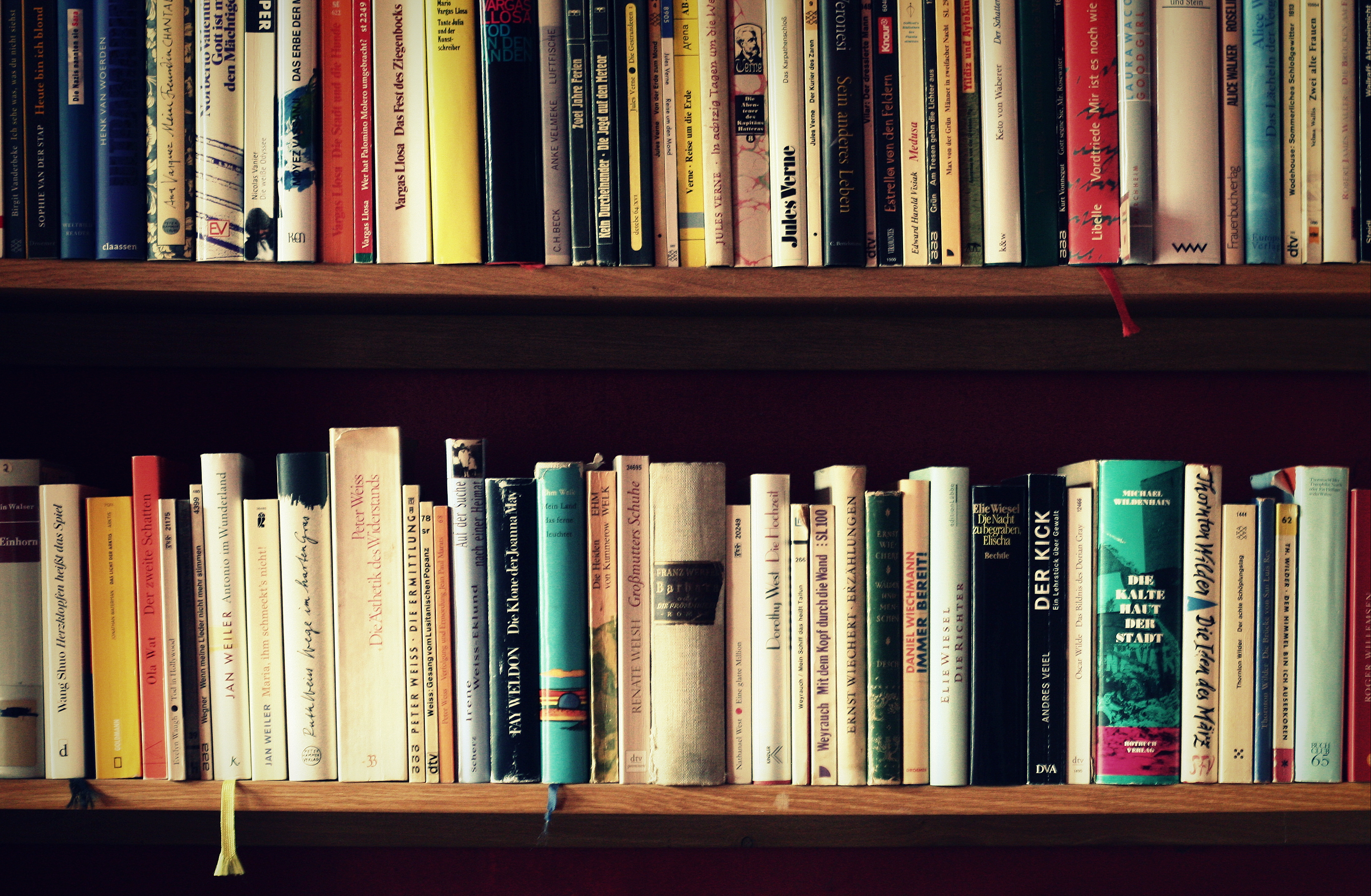„Behindert“, „anders begabt“, „besonders befähigt“… was sagt man heutzutage und was ist beleidigend? Wir haben einige Begriffe zur Beschreibung von behinderten Menschen gesammelt. Eins schon mal vorab: Wenn ihr euch unsicher seid, fragt die Person selbst, wie sie gerne benannt werden möchte!
Ableism/ Ableismus/ Behindertenfeindlichkeit
Benennt die Auf- und Abwertung von Menschen nach ihnen zugeschriebenen Fähigkeiten, was zur Diskriminierung von chronisch kranken und behinderten Menschen führt.
Ableismus geht von einem physischen und psychischen Idealstandard des Menschen aus, dem chronisch kranke und/oder behinderte Menschen nicht gerecht werden können.
Sie gelten demzufolge als „minderwertig“. Auf sozialer Ebene bedeutet es, dass behinderte und/oder chronisch kranke Menschen oft ausgeschlossen und unsichtbar gemacht werden.
Behinderter Mensch, Mensch mit Behinderung
„Darf ich Sie ‚behindert‘ nennen?“ Diese Frage ist für viele behinderte Menschen Alltag. Seitdem Teenager sie auf Schulhöfen als Schimpfwörter benutzen, sind die Worte „Behinderung“ und „behindert“ in Verruf geraten. Zu Unrecht, denn für viele behinderte Menschen ist es eine neutrale Beschreibung eines Merkmals. Wichtig ist nur das Wort “Mensch”, da mit dem Begriff “Behinderte” das Bild einer festen Gruppe entsteht, die in Wirklichkeit vielfältig ist. „Der/die Behinderte“ reduziert die Person auf ein Merkmal, das alle anderen Eigenschaften dominiert. Das ist auch der Fall, wenn von „den Blinden“ oder “den Gehörlosen” die Rede ist.
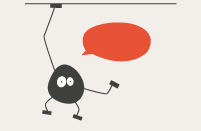
„Behinderung“ – Bedeutungswandel eines Begriffs
Wie eine Gesellschaft ihre Mitglieder benennt, sagt viel über deren Akzeptanz aus. Für die Formulierung „Menschen mit Behinderung“ war es in Deutschland ein langer Weg, der mit der diskriminierenden Bezeichnung „Krüppel“ begann.
Beeinträchtigung, beeinträchtigt
Seit ein paar Jahren haben sich neue Begriffe etabliert „Menschen mit Beeinträchtigungen“ und „beeinträchtigte Menschen“. Viele sind verwirrt: „Ist ‚beeinträchtigt‘ jetzt das neue ‚behindert‘?“ Wir sagen: Jein. Die Disability Studies unterscheiden zwischen Beeinträchtigung und Behinderung: Die Beeinträchtigung ist die körperliche Seite der Behinderung – das fehlende Bein oder die fehlende Sehkraft, die chronische Krankheit. Bei „Behinderung“ kommt eine soziale Dimension dazu – Barrieren behindern und schließen aus, und das macht die Beeinträchtigung oft erst zum Problem.
Menschen mit Handicap
In Deutschland wird der Ausdruck „Menschen mit Handicap“ oft rein euphemistisch gebraucht, als Ersatz für Menschen mit Behinderung. Bei Nutzung des Wortes kann die Gefahr bestehen, dass das soziale Modell der Behinderung außer Acht gelassen wird. Dieses besagt, eine Person ist nicht nur behindert, sondern wird auch durch die Umwelt behindert (durch Vorurteile, Stufen, fehlende Untertitel usw.). Deutsch-englische Wortfusionen wie „gehandicapt“ oder “gehandicapiert” sollte man ohnehin vermeiden. Mehr Informationen zum Ursprung des Begriffs haben wir ein einem Artikel zusammengefasst.

Warum „Handicap“ das falsche Wort für Behinderung ist
Immer häufiger wird das Wort „Handicap“ benutzt, um den Begriff der „Behinderung“ zu vermeiden. Warum dies aber der falsche Weg ist und warum die häufig genannte Begründung dafür auch nicht stimmt, erklärt Jonas Karpa.
Mensch mit besonderen Fähigkeiten oder Bedürfnissen
Da viele befürchten, allein mit dem Wort „Behinderung“ zu beleidigen oder zu stigmatisieren, hat sich eine Reihe von beschönigenden Alternativ-Ausdrücken, wie z.B. „besondere Bedürfnisse“ oder „andersfähig“ etabliert. Ganz abgesehen davon, dass nur wenige behinderte Menschen selbst diese Ausdrücke gebrauchen: Sie treffen einfach nicht zu. Die Fähigkeiten und Bedürfnisse behinderter Menschen sind nicht „besonders“, sondern genauso vielfältig wie die nicht behinderter Menschen.
Die Gesunden und Kranken
Gesundheit ist genauso wie „Normalität“ eine konstruierte Vorstellung – jeder Mensch hat seinen eigenen Blick darauf. Krankheit heißt für die meisten Menschen, von einem Leiden befallen zu sein, von dem sie geheilt oder an dem sie schlimmstenfalls sterben werden. Behinderung hingegen ist in der Regel etwas Dauerhaftes, etwas, das nicht einfach weggeht, aber auch kein ständiges Leiden verursachen muss. Daher ist das Gegenteil von “behindert” einfach “nicht behindert” und nicht “gesund” – auch ein behinderter Mensch kann mal einen Schnupfen haben, also krank sein, und dann wieder genesen.

Schizophrenie, Depression, Suizid – Tipps für Medien
In welchem Kontext wird meist über Menschen mit psychischen Erkrankungen berichtet? Und welche klischeehafte Bildsprache wird verwendet? Auf dem Workshop “Journalistische Berichterstattung über Menschen mit psychischen Erkrankungen”, organisiert vom Aktionsbündnis Seelische Gesundheit, trafen sich Psychiater, Journalisten und Betroffene. Lilian Masuhr hat daran teilgenommen.

„Nur wer einen Verstand besitzt, kann ihn auch verlieren.“
Psychische Krisen kennen wir vor allem durch die vermehrte Berichterstattung über das „Burnout-Syndrom“. Dabei gibt es ganz verschiedene Ausprägungen von Krisen. Doch obwohl in Deutschland viele Menschen von etwa Depression oder Schizophrenie betroffen sind, bleiben diese Einschränkungen unsichtbar. Heike Oldenburg versucht eine Einordnung.
“Invalide/Invalidität”
„Invalide“ leitet sich aus dem Lateinischen ab und bedeutet soviel wie „kraftlos“, „schwach“ und „hinfällig“. Verwandt ist der Begriff mit Wörtern romanischer Sprachen, die zum Beispiel „unwert“, „ungültig“ oder „untauglich“ bezeichnen. Allein deswegen sollte man auf „invalide“ und „Invalidität“ verzichten – abgesehen davon sind diese Begriffe veraltet.
„Die Normalen”
Sicher gibt es mehr Menschen die laufen, gut sehen oder hören können als solche, die das nicht gut können. Dennoch ist die Vorstellung einer fixen Normalität fragwürdig. Wo genau das „Normale“ anfängt und wo es aufhört – dazu gibt es viele Meinungen. Deswegen sind die Kategorien „normal“ oder „anormal“ auch nicht besonders geeignet, Menschen mit und ohne Behinderung zu beschreiben.
„Der Rollstuhl”
Dass behinderte Menschen mit ihren Hilfsmitteln gleichgesetzt werden, kommt immer wieder vor. Besonders „gut“ darin sind manche Mitarbeiter der Bahn: „Hier steigt noch ein Rollstuhl ein“ heißt es zuweilen beim Service-Personal auf dem Bahnsteig. Der darin sitzende Mensch wird dabei unwichtig. Dass sie als geschlechtsneutrale Objekte wahrgenommen werden, passiert behinderten Menschen sowieso häufig – gut, wenn das nicht noch alltagssprachlich untermauert wird.
„Taubstumm“
Gehörlose Menschen sind nicht „stumm“ oder „taubstumm“, sondern können genauso wie Hörende sprechen, entweder in der Gebärdensprache (die übrigens auch keine „Zeichensprache“ ist) oder lautsprachlich. „Gehörlos sein“ bzw. Gehörlosigkeit sind neutrale Begriffe, die deshalb von vielen nicht hörenden Menschen bevorzugt werden.
Einige von ihnen stören sich aber auch an dem Begriff der Gehörlosigkeit, weil er zu defizitär wirkt. Sie nennen sich weiterhin „taub“ und zeigen damit, dass das Taub-Sein eine ihrer vielen Eigenschaften ist. Beachten sollte man allerdings, dass das Wort „taub“ auch oft synonym verwendet wird für „Ignoranz“ oder „Nicht-hinhören-wollen“ – eine Metapher, die man vermeiden kann. Menschen, deren Hörvermögen eingeschränkt ist, bevorzugen Begriffe wie „schwerhörig“ oder „hörbehindert“.

Stumm geschrieben
Die Bloggerin Julia Probst liest nicht nur von den Lippen ab, sondern auch viele Artikel. Dabei fällt ihr im Zusammenhang mit Gehörlosigkeit auf, dass Journalisten die Protagonisten manchmal viel „stummer“ beschreiben, als diese eigentlich sind. Für „old.leidmedien.de“ hat Julia Probst einen ihrer Blogbeiträge zur Verfügung gestellt.

Blindheit und Sehbehinderung – raus aus der absoluten Dunkelheit
„Was könnte den Leser interessieren?“ – Diese Frage stellen sich Redaktionen jeden Tag. Dabei ist das Außergewöhnliche manchmal auch einfach nur der Alltag. So möchte der Blogger Heiko Kunert lieber Berichte über alltägliche Probleme von Menschen mit Behinderungen lesen, als über „Superblinde“.
Autist*in
Im Gegensatz zum Ausdruck “Mensch mit Behinderung” oder “behinderter Mensch” haben wir von Autist*innen im Gespräch erfahren, dass sie so genannt werden wollen, da der Autismus sie als Menschen ausmache, wie sie z.B. die Welt wahrnehmen, also nicht getrennt vom Menschen betrachtet werden solle. Hieße es “Mensch mit Autismus”, wäre es etwas, das außerhalb der Person stünde. Gerade bei autistischen Personen ist die Sorge groß, dass ihr Autismus wegtherapiert werden soll (siehe die Debatte um die Therapieform ABA in den Medien).

Kein Rain Man – Über Autismus berichten
Als Dustin Hoffman in dem Hollywood-Klassiker „Rain Man“ Karten und Streichhölzer in rauschender Geschwindigkeit zählte, wurde für viele Zuschauer ein Bild über Autisten geboren. Der Blogger bestOfCrumbs möchte das Bild vom „Hochbegabten“ aber „emotionslosen Menschen“ gerade rücken und es lieber um viele Facetten erweitern.
Chronisch krank
Ab wann eine Erkrankung als „chronisch“ gilt, ist in der Medizin umstritten – manchen Fachleuten reichen vierzehn Tage, für andere beginnt sie erst ab drei Monaten Krankheitsdauer. Allgemein sind Krankheiten chronisch, wenn sie andauern und es für sie keine Heilung gibt. Damit ist der Übergang zu Behinderung fließend: Chronische Krankheiten und dauerhafte Beeinträchtigungen wie zum Beispiel Multiple Sklerose (MS), Depression, Diabetes oder manche Krebs- oder Herzerkrankungen können zu Behinderungen werden.
“Geistige Behinderung”
Der Begriff „geistige Behinderung“ ist momentan umstritten. Vielen gilt er nach wie vor als neutrale Bezeichnung für Menschen, die große Probleme mit dem Lernen und Schwierigkeiten haben, abstrakte Dinge schnell zu verstehen. Viele der so bezeichneten Menschen aber lehnen den Begriff „geistige Behinderung“ ab und nennen sich lieber Mensch mit Lernschwierigkeiten. Sie finden, dass nicht ihr „Geist“ behindert ist, und dass „geistige Behinderung“ sie als ganzen Menschen schlecht macht. Mehr Informationen gibt es unter www.People1.de. Auch „Mongo“ und “mongoloid” ist veraltet und diskriminierend: zum einen behindertenfeindlich gegenüber Menschen mit Trisomie 21 / Down-Syndrom; zum anderen rassistisch, da es eine Anspielung auf die angeblich „asiatische“ Augenform von Menschen mit Trisomie 21 ist.
„Krüppel“
Behinderte Menschen als „Krüppel“ zu bezeichnen war bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts normal, gilt aber heute als sehr beleidigend. Einige behinderte Menschen haben sich diesen Begriff jedoch positiv angeeignet: Sie nennen sich selbst „Krüppel“ – nicht abwertend sondern selbstbewusst. Angelehnt ist diese Praxis an andere Minderheiten – homosexuelle Männer beispielsweise definierten die einstige Beleidigung „schwul“ erfolgreich um. Im Gegensatz zu „schwul“ ist „Krüppel“ aber noch kein neutraler Begriff und kann positiv nur innerhalb der Gruppe behinderter Menschen verwendet werden.
“Pflegefall”
Behinderte Menschen als „Pflegefall“ zu bezeichnen reduziert sie auf Pflegebedürftigkeit. Wenn Menschen zu „Fällen“ werden, werden sie als Objekte und Last für die Allgemeinheit wahrgenommen. Sogenannte „Pflegefälle“ bekommen vielleicht auch Persönliche Assistenz: Eine Form der alltäglichen Unterstützung, in der behinderte Menschen selbst Entscheidungen treffen können. Die Form der Pflege oder Assistenz, die ein behinderter Mensch bekommt, kann also unterschiedlich sein.
„Spast”, „Spacko“ und „Wasserkopf“
Solche Ausdrücke lösen negative Assoziationen aus, und auch der „Spast“ hält schnell bei einem Wutausbruch hin und ist immer abwertend gemeint. Vielen behinderten Menschen ist daher eine neutrale Bezeichnung lieber, zum Beispiel der Fachausdruck. Der Mensch mit „Wasserkopf“ wird so zum Mensch mit „Hydrocephalus“, und der „Spastiker“ zum Mensch mit „Cerebralparese“. In jedem Fall gilt – fragen Sie die Betroffenen selbst, wie sie bezeichnet werden wollen.
„Zwerge“ und „Liliputaner“
Von „Zwergen“ oder „Liliputanern“ sprach man früher – aber genauso wie sich Zwei-Meter-Menschen ungern Riesen nennen lassen, empfinden viele Menschen mit geringer Körpergröße diese Bezeichnungen als diskriminierend. Zwerge, Riesen und Liliputaner gehören ins Reich der Märchen. „Kleinwüchsig“ ist da neutraler, meinen die Bundesselbsthilfe Verband Kleinwüchsiger Menschen e.V. und der Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien e.V.
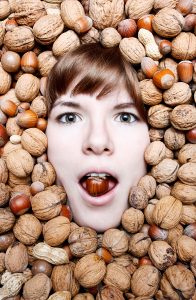
Blinde Kuh trifft Taube Nuss – Metaphern der Behinderung
Es gibt viele Metaphern rund um „Behinderung“. Generell helfen uns Metaphern, abstrakte Situationen, Gefühle, Gegenstände und vieles mehr auszudrücken. Doch mit der Zeit können aus Metaphern auch Floskeln werden, die unbedacht geäußert werden und eigentlich nur noch windschiefe Bilder sind. In der Glosse von Rebecca Maskos trafen sich solche Wortbilder auf einen Kaffee.

Monster, Freaks & Kuriositäten – historische Figuren
„Einarmige“, „Zwerge“ oder „Siamesische Zwillinge“ – ungewöhnliche Körper haben schon immer großes Interesse auf sich gezogen. Bereits auf steinzeitlichen Höhlenmalereien findet man Darstellungen von behinderten Neugeborenen. Denker wie Aristoteles und Cicero haben sich mit dem Thema Behinderung beschäftigt. Sie war ein Symbol, das interpretiert werden musste, stand für göttlichen Zorn oder ein übernatürliches Zeichen.
Weitere Perspektiven:

Sätze, die Menschen mit Behinderung oft hören
In der Reihe „Things Not To Say“ von BBC Three erzählen behinderte Menschen, welche Sätze sie oft hören und was sie dazu sagen. Auf unterhaltsame Art erfahrt ihr hilfreiche Tipps für den ersten Small-Talk.

Zur Geschichte des Umgangs mit Behinderung
Über die Jahrhunderte hinweg wurden behinderte Menschen immer wieder ausgegrenzt oder vorgeführt. Fehlende Rechte erschwerten ihnen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dennoch hat sich für Menschen mit Behinderung vieles verbessert, auch wenn Inklusion im 21. Jahrhundert noch nicht erreicht worden ist.

Von Klischees freischwimmen
Christiane Reppe ist eine leidenschaftliche Schwimmerin und verbringt so viel Zeit im Wasser und Fitnessraum, wie andere Menschen im Büro. Trotzdem sind einige Medien mehr an ihrer Behinderung als an ihren Leistungen interessiert.

Ist das wirklich so schwer?
Von 2003 bis 2007 dokumentierte die Kommunikations-Beraterin und Autorin Annette Schwindt Partnerschaften, in denen einer der beiden Partner behindert ist und der andere nicht. Auch 2012 bekommt sie noch Anfragen zu der Doku. Dabei werden oft Behinderung und Gesundheit verwechselt. Ein Erfahrungsbericht.
Zum Ausdrucken:
Tabelle: Wie man gängige Sätze anders formulieren kann, (pdf)
Beate Firlinger: „Buch der Begriffe. Sprache, Behinderung, Integration.“ Integration:Österreich, 2003 (pdf)